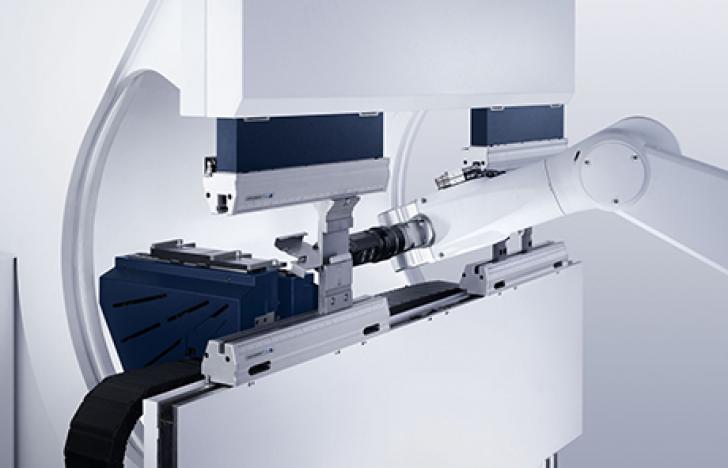Die süße Tugend des Nichtstuns
 Photos.com
Photos.com
Das Recht auf Arbeit sei eine kapitalistisch-religiöse Platitüde, meint Paul Lafargue.
Man kann vom ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder halten, was man will, er hat jedenfalls seine Frühsozialisten gelesen. „Es gibt kein Recht auf Faulheit“, tönte der sozialdemokratische Ex- Kanzler im Jahr 2001 via Bild- Zeitung und meinte damit die damals rund vier Mio. Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger im Land, die er damit gleich einmal alle als Arbeitsverweigerer über einen Kamm scherte.
Woher kam allerdings der flotte Spruch? Das Recht auf Faulheit, im Originaltitel Le droit à la paresse, entstammt der Feder des Frühsozialisten Paul Lafargue und ist im Jahr 1880 zum ersten Mal erschienen und danach viele Male nachgedruckt worden. Lafargue analysierte den zu seiner Zeit aufkommenden Begriff der Arbeit als Lebensinhalt, als Grundlage von Wohlstand und als Struktur des Daseins in seinen Grundlagen. Er kam zu dem Schluss, dass es sich bei der „Arbeitssucht“ und dem „Arbeitsglück“ lediglich um eine bestimmte moralische Grundlage der Bourgeoisie und des frühen Kapitalismus handelte, die damit der neu entstehenden Arbeiterklasse ihre ethischen Grundlagen geben wollten.
Seltsame Arbeitssucht
„Die kapitalistische Moral, eine jämmerliche Kopie der christlichen Moral, belegt das Fleisch des Arbeiters mit einem Fluch; ihr Ideal besteht darin, (...) den Produzenten zur Rolle einer Maschine zu verurteilen, aus der man pausenlos und gnadenlos Arbeit herausschindet“, schreibt Lafargue.
Diese „seltsame Arbeitssucht“, die den Menschen „ein organisches Bedürfnis“ ist, wird von ihm gnadenlos zerpfl ückt. Und so kommt er auch zu folgendem Schluss: Das „Grundrecht auf Arbeit“, wie es die Französische Revolution formulierte, führe den Arbeiter immer mehr in die Ver elendung, aus der er glaubt, nur durch mehr Arbeit herauszukommen. Zu viel Arbeit führe zu Überproduktion, laut Lafargue zu seiner Zeit etwa ein Grund für den Kolonialismus und die daraus folgenden Probleme.
Die Religion der Arbeit müsse widerlegt werden, und zwar mit dem „Recht auf Faulheit“. Lafargue bemüht viele historische Beispiele, etwa die alten Griechen, die in der Zeit ihrer höchsten Blüte nur Verachtung für die Arbeit hatten; den Sklaven allein war es gestattet zu arbeiten, der freie Mann kannte nur körperliche Übungen und Spiele des Geistes, bemerkt Lafargue.
Welches seien in der Gesellschaft die Klassen, welche die Arbeit um der Arbeit willen lieben? „Die Kleinbauern und Kleinbürger, welche, die einen auf ihren Acker gebückt, die anderen ihren Geschäften hingegeben, dem Maulwurf gleichen, der in seiner Höhle herumwühlt, und sich nie aufrichtet, um mit Muße die Natur zu betrachten“, so Lafargue in seiner Schrift, die im Gegensatz zu Marx und Engels damals den Fortschrittsgedanken komplett zurückwies und auch den Konsumgedanken der Frühindustrialisierung in Form der Massenproduktion ablehnte. Nicht zuletzt deswegen war seine Schrift im gesamten Ostblock bis zur Wende in den 1990er Jahren verboten.
In der Tat hat der Gedanke der Anti-Arbeit beziehungsweise der Faulheit eine lange historische Tradition. So schreibt etwa Herodot: „In Athen waren nur die Bürger wirkliche Edle, die sich mit der Verteidigung und Verwaltung der Gemeinschaft beschäftigten. (...) Um mit ihrer geistigen und körperlichen Kraft die Belange der Republik wahrzunehmen, mussten sie über ihre ganze Zeit frei verfügen und beluden die Sklaven mit der ganzen Arbeit.“
Plato wiederum schreibt in seiner Gesellschaftsutopie des Philosophenstaates, dass „die Natur weder Schuhmacher noch Schmiede geschaffen hat; solche Berufe entwürdigen die Leute, die sie ausüben.“ Und Cicero stellte in seinem Werk Über die Pfl ichten recht deutlich klar, was er von Arbeit hielt: „Wer seine Arbeit für Geld hergibt, verkauft sich selbst und stellt sich auf eine Stufe mit den Sklaven.“
Das Lohnsystem, schließt Lafargue daraus, die Lohn arbeit an sich sei „die schlimmste Sklaverei“ überhaupt: „Man führe die Arbeit ein, und adieu Freude, Gesundheit, Freiheit – adieu alles, was das Leben schön, was es wert macht, gelebt zu werden.“ Der österreichische Soziologe Bernd Marin hat sich der Thematik nach dem Schröder- Ausspruch angenommen und versucht, den Begriff „Faulheit“ auf heute gültige, moderne Bedingungen umzumünzen: Faulheit sei heute eher gleichzusetzen mit der „Präferenz für Freizeit“, meint Marin, und zwar eine „Freizeit“, die sich nicht aus Mitteln der Sozialleistungen speist.
Freie Gesellschaften würden nämlich weder Zwangsarbeit noch Arbeitszwang kennen und müssten eine „Faulheit“ eines Teils der Mitglieder dieser Gesellschaft hinnehmen können müssen, solange die „Faulen“ nicht am sozialen Tropf hängen, sondern ihre Utopie des süßen Nichtstuns innerhalb der Ellbogengesellschaft selbst organisieren – wie immer das auch gelingen soll oder kann.
Mittagsschlaf über allem
Wie man richtig faul ist, kann man sich von der literarischen Vorlage Oblomow von Iwan Gontscharow abschauen. Oblomow, ein russischer Adeliger, legt eine beispiellose, methodische Trägheit und Faulheit an den Tag. In seinem dauernden Schlummer vergisst er die Menschen, den Zwang, die Ordnung der Dinge und überhaupt alles außer seinen Mittagsschlaf, der das zentrale Ereignis seines Tages ist. Diese Faulheit ist allerdings extrem, sie beinhaltet keinerlei Muße, die sich Lafargue unter Faulheit vorstellt.
Ausgewählter Arikel aus dem Jahr 2007