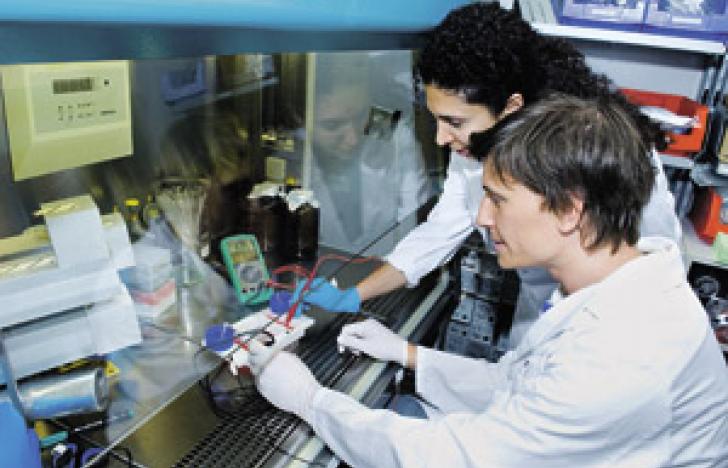Nuklearmediziner um Zukunft besorgt
 EPA
EPADie Nuklearmediziner schlagen Alarm: Der Ausfall der veralteten Reaktoren hat europaweit einen Radioisotop-Mangel ausgelöst. Der Versorgungsengpass bedroht akut die Gesundheit Tausender Tumorpatienten.
Überall in Europa gibt es seit Monaten Engpässe bei der nuklearmedizinischen Versorgung. Grund ist der annähernd zeitgleiche Ausfall der Reaktoren, die Molybdän-99 erzeugen. Davon gibt es weltweit nur fünf Anlagen. Der für Europa wichtigste Reaktor im niederländischen Petten ist nach einem Leck im Kühlsystem nicht wieder in Betrieb genommen worden.
Auch die beiden anderen europäischen Reaktoren in Belgien und Frankreich, die Isotope für die nuklearmedizinischen Zentren produzieren, waren zeitweilig wegen Wartungsarbeiten außer Betrieb. Außerhalb Europas gibt es noch Reaktoren in Kanada und Südafrika. Der Forschungsreaktor im deutschen Jülich, der ebenfalls Molybdän-99 erzeugen konnte, wurde bereits 2006 abgeschaltet.
Von den Nuklearmedizinern dringend für die Untersuchungen benötigt wird eigentlich Technetium-99m, das als Zerfallsprodukt des wiederum bei der Spaltung von Uran anfallenden Molybdän-99 entsteht. Die Gammastrahlung, die das in den Körper eingeschleuste Technetium-99m aussendet – diese Untersuchung wird als Szintigrafie bezeichnet –, kann gemessen werden und gibt dann Hinweise auf die Durchblutung von Organen oder auf Entzündungsherde oder Tumore. Die Bedeutung der nuklearmedizinischen Diagnostik insgesamt ist unbestritten sehr groß. Untersuchungen vor und während Brustkrebsoperationen, bei Chemotherapien, vor und nach Transplantationen, zur Vorbereitung bei Herzoperationen und bei der Diagnostik und Behandlung von Tumoren werden von den Nuklearmedizinern durchgeführt.
Für einen erheblichen Teil der Patienten bedeutet der Versorgungsengpass eine akute Gefahr für ihre Gesundheit. Besonders bei schnell wachsenden Tumoren kann eine fehlende Therapiemöglichkeit lebensbedrohend sein.
Im Februar und Mai sei wegen neuerlicher Wartungs-arbeiten an den Reaktoren wieder mit einer Verschärfung der Situation zu rechnen, warnte jetzt die deutsche Gesellschaft für Nuklearmedizin. Der aktuelle Notstand in der Nuklearmedizin – viele Szintigrafien fallen ganz aus oder werden verschoben – hat auch die Politik alarmiert. Die Gesundheitsminister der EU-Länder haben das Beratergremium für Krisensituationen einberufen.
Garching als Lösung
Eine Lösung wäre die Nutzung der Forschungsneutronenquelle in Garching. Betreiber ist die Technische Universität (TU) München, Eigentümer das Landes Bayern. Winfried Petry, wissenschaftlicher Direktor in Garching, sagte im Gespräch mit economy, die Forschungsneutronenquelle sei eine moderne Anlage, die bereits andere Isotope für medizinische Zwecke produziere. Der Reaktor müsse nur um eine Einheit zur Erzeugung von Molybdän-99 ergänzt werden. Dann könne Europa zu großen Teilen von Garching aus versorgt werden. Der Finanzierungsbedarf betrage fünf Mio. Euro. Eine Anpassung sei zügig möglich. Der Bau eines gänzlich neuen Kernreaktors würde 400 Mio. Euro kosten und mindestens zehn Jahre dauern. Eine Herstellung von Molybdän-99 durch Elektronenbeschleunigung, wie Thomas Ruth vom kanadischen Labor für Partikel- und Nuklearphysik in Vancouver in der Zeitschrift Nature vorschlägt, hält Petry weder wissenschaftlich noch ökonomisch für sinnvoll.
Handeln ist jedenfalls dringend angesagt, warnen die Nuklearmediziner. „Da die Reaktoren aus den 1950er und 1960er Jahren stammen, wird aus derzeitiger Sicht der letzte 2015 abgeschaltet werden müssen“, betont Markus Mitterhauser vom Wiener AKH.
In vielen Fällen sei auch ein Ausweichen auf eine moderne, weitere Untersuchungsmethode, die PET-CT (Positronen-Emissions-Tomografie in Kombination mit Computertomografie), ein durchaus möglicher Ausweg aus der Krise, meint Mitterhauser. Während die CT eine rein topografisch-anatomische Information vermittelt, gibt die PET über funktionelle Strukturen (zum Beispiel aktives Tumor-Gewebe) Auskunft. Vereinfacht ausgedrückt weiß die CT, „dass da etwas sein muss“, während die PET zeigt, „was da ist“.
In Kombination eingesetzt, kann in einer einzigen Untersuchung ermittelt werden, wo exakt ein Tumor sitzt oder sich eine Lymphknotenmetastase befindet. „Dadurch sehen wir sofort, ob der Patient durch eine Operation geheilt werden kann“, schwärmt Primar Alexan-der Becherer vom Landeskrankenhaus (LKH) Feldkirch.
Die noch junge PET-CT – das erste Gerät weltweit kam 2001 auf den Markt, in Österreich bot als Erstes das PET-CT-Zentrum Linz am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern im Jänner 2003 die Untersuchung an – findet immer mehr Anklang und wird von einer steigenden Zahl von medizinischen Fächern in Anspruch genommen, etwa in der Chirurgie (Indikationsstellung und Operationsplanung), der Dermatologie (Aufspüren von Melanomgeweben), der Pulmologie (Lungenkrebs), der Radiotherapie (Zielbestimmung und Erfolgskontrolle) sowie der generell der Onkologie, also Krebsforschung (Therapiekontrolle).
Kritik an Krankenkassen
„Nicht mitgemacht haben diesen Entwicklungsschub allerdings die Sozialversicherungsträger“, kritisiert Christian Pirich, Vostand der Universitätsklinik für Nuklearmedizin am LKH Salzburg. „Es ist ein Paradoxon, dass die Geräte von den Spitalserhaltern gekauft werden müssen und die Untersuchungen nicht bezahlt werden, es gibt keinerlei Refunding dafür“, poltert Pirich und fährt fort: Es werde nicht verstanden, „wie sehr die PET-CT sinnlose Operationen vermeidet, onkologische Therapien durch verfeinerte Therapiekontrolle und -abstimmung erfolgreicher macht oder die Früherkennung und rechtzeitige Behandlung von Tumoren ermöglicht.“
Pirich fordert daher ein „rasches und zukunftsorientiertes Umdenken zum Nutzen der Patienten“.
Die PET-CT ist ein entscheidender Fortschritt in der Onkologie, darüber sind sich die Mediziner einig. „Die PET-CT ist allerdings keine neue diagnostische Wundermethode, die alle anderen Untersuchungen überflüssig werden lässt“, betont Markus Raderer vom Wiener AKH und Spezialist für maligne Lymphome (bösartige Erkrankungen bei Lymphknoten, Rachenmandeln, Milz und Knochenmark). Es sei wichtig, dass nicht jeder Patient unkritisch die PET-CT durchläuft, „wenn andere Methoden gleich gut oder sogar besser sind“, stellt Raderer klar. Die PET-CT könne jedenfalls keinesfalls die konventionelle Überprüfung von Gewebeproben ersetzen, sagt der Wiener Mediziner.